This is a SEO version of 110808_KT_August-September_web_ID17186. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »47
46
FORSCHUNG
Die chronische Herzmuskelschwäche kann künftig möglicherwei-se mit Hilfe der Gentherapie behandelt werden. Ein Forscherteam aus Heidelberg und Philadelphia unter Federführung von Profes-sor Dr. Patrick Most von der Abteilung für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie berichtet in der Zeitschrift „Science Translatio-nal“ über eine erfolgreiche Studie an Schweinen, bei der die gene-tische Information für das Protein S100A1 mit Hilfe eines Virus als Genfähre in den Herzmuskel eingebracht wurde. Frühere Studien von Professor Most und Dr. Pleger hatten den Nachweis erbracht, dass der erkrankte Herzmuskel einen Mangel an S100A1 aufweist, der für den fortschreitenden Verlust der Herzkraft und die erhöhte Anfälligkeit für Rhythmusstörungen verantwortlich ist.
Die eingebrachte Information versetzt die Herzzellen in die Lage, S100A1 zu bilden: Nach drei Monaten hatte sich die Herzfunktion der behandelten Tiere deutlich erholt. „Wir planen nun eine kli-nische Studie, bei der die Sicherheit der Therapie am Menschen getestet wird“, erklären die beiden Hauptautoren. Bislang gibt es keine Therapie, die den Verlauf der chronischen Herzmuskel-schwäche stoppen oder gar umkehren könnte.
Gentherapie macht Schweine-Herzen wieder fit
Herzmuskelzellen beim Men-schen (siehe Foto) ähneln stark denen beim Schwein. Die beim
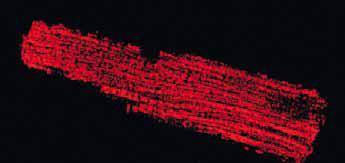
Einfangen und Ausspülen oder gar nicht erst in den Körper gelangen lassen – das sind die beiden gängigen Therapiekon-zepte bei der angeborenen Kupferspei-cherkrankheit Morbus Wilson. Ziel beider Ansätze, die bisher als gleichwertig galten, ist es, die lebensgefährlichen Kupfereinla-gerungen im Körper abzubauen. Wissen-schaftler um Professor Dr. Wolfgang Strem-mel, Ärztlicher Direktor der Abteilung für Gastroenterologie, Infektionskrankheiten und Vergiftungen, und des Universitätskli-
nikums Wien haben nun erstmals in einer Vergleichstudie gezeigt: Medikamente, die als Kupferfänger überschüssiges Kupfer binden (Chelatbildner) und über die Nie-ren ausscheiden, wirken zuverlässiger als Zinksalze, die die Kupferaufnahme im Darm hemmen. Das bislang größte For-schungsregister lieferte Daten von 288 Pa-tienten für die Studie. Bei Morbus Wilson lagert sich Kupfer in der Leber und anderen Organen ab, es kommt u.a. zu Leberzirrho-se bis hin zum Leberversagen. Die Wissen-
schaftler entdeckten bei Patienten, deren Leberfunktion sich trotz Zinktherapie ver-schlechterte, charakteristische Verände-rungen bestimmter Leberwerte und der Kupfermenge im Urin – noch bevor weitere Leberzellen abstarben. „Damit haben wir erstmals Marker beschrieben, die schon früh Hinweise darauf geben, dass die The-rapie nicht anschlägt“, erklärt Studienlei-ter Dr. Karl-Heinz Weiss. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Gastroente-rology“ veröffentlicht.
Morbus Wilson: Kupferfänger wirken zuverlässiger
Darmkrebspatienten, deren Tumor bereits Lebermetastasen gebildet hat, proftieren eher von einer Chemotherapie, wenn am Rand der Metastasen eine erhöhte Anzahl von bestimmten Immunzellen vorhanden ist. Das haben Wissenschaftler um Profes-sor Dr. Dirk Jäger, Ärztlicher Direktor der Abteilung Medizinische Onkologie am Na-tionalen Centrum für Tumorerkrankungen
(NCT), bei der Analyse von 101 Gewebepro-ben operierter Patienten beobachtet. Bei Darmkrebs wird ergänzend zur Operation oftmals eine Chemotherapie oder Strah-lentherapie durchgeführt. „Viele Patienten leiden unter den starken Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Deshalb ist es wich-tig, diejenigen Patienten zu identifzieren, die von einer solchen Therapie nicht prof-
tieren würden, und damit unnötige Be-handlungen zu vermeiden“, so Jäger. Die Studie wurde zusammen mit der For-schungsgruppe von Privatdozent Dr. Niels Grabe im BIOQUANT durchgeführt. Ziel ist es, ein in der klinischen Praxis einsetz-bares Verfahren für die Bestimmung die-ses Markers zu entwickeln.
Reges Immunsystem unterstützt Chemotherapie
In der Universitätsmedizin entwickeln sich derzeit neue Berufsbilder, die den höheren Ansprüchen an eine Zusammenarbeit aller Berufsgruppen Rechnung tragen. Klinikum und Fakultät reagieren darauf mit dem neuen Bachelor-Studiengang „Interprofes-sionelle Gesundheitsversorgung“ („Inter-professional Health Care“), der zum Win-tersemester 2011/2012 startet. Der achtsemestrige Studiengang richtet sich an Abiturienten, die zusätzlich zu einer Ausbildung in einem Gesundheitsberuf wissenschaftliche Grundlagen erwerben wollen, und ist in seiner inhaltlichen Aus-richtung deutschlandweit einmalig.
Die Studierenden absolvieren fünf Semester begleitend zu der dreijährigen Ausbildung – in Altenpfege, Gesundheits- und Kranken-pfege, Gesundheits- und Kinderkranken-pfege, Hebammenwesen, Logopädie, Me- dizinisch Technische Laborassistenz, Medi-zinisch Technische Röntgenassistenz, Or-thoptik oder Physiotherapie – an der Akade-mie für Gesundheitsberufe (AfG), die rest- lichen drei Semester im Anschluss an ihren Ausbildungsabschluss. Die Bachelor-Arbeit schreiben sie im letztenSemester und erwer-ben damit einen zweiten Abschluss.
Neben der Vermittlung grundlegender Kenntnisse wissenschaftlichen Arbeitens ist das Ziel des Studiengangs, die Zusam-menarbeit zwischen den Berufsgruppen und das Verständnis untereinander zu ver-bessern. „Erste Studien deuten darauf hin, dass Interprofessionelles Lernen positive Auswirkungen sowohl auf die Zusammen-
arbeit wie auch auf die Patientenversor-gung hat“, so Pfegedirektor Edgar Reisch. „Eine Vernetzung der Einrichtungen und der darin arbeitenden Personen ist not-wendig, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung effektiv und effzient zu gestalten“, erklärt Professor Dr. Joachim Szecsenyi, Ärztlicher Direktor der Abtei-lung Allgemeinmedizin und Versorgungs-forschung und Leiter des Studiengangs.
Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Berufgruppen
„Die Studierenden erweitern ihre Perspekti-ve und werden dazu befähigt, Strategien für eine effektive, kollegiale und interdiszipli-näre Zusammenarbeit mit dem Fokus einer optimalen Gesundheitsversorgung zu ent-wickeln“, ergänzt die wissenschaftliche Mit-arbeiterin Dr. Cornelia Mahler. Der Studien-gangbietenichtnureineZusatzqualifkation in den Gesundheitsberufen, sondern eröff-ne den Absolventen auch Tätigkeitsfelder etwa im Projekt-Management oder in der Forschung – und könne der berufichen Kar-riere dadurch einen deutlichen Schub ver-leihen. So könnte beispielsweise ein Alten-pfeger, der den Studiengang absolviert hat, die erworbenen Kompetenzen einset-zen, um für ein Pfegeheim ein Gesund-heitsförderungsprogramm für ältere Diabe-
tespatienten zu entwickeln. Er ist darauf vorbereitet, wie in diesem Fall mit Ernäh-rungswissenschaftlern, Psychologen, Medi-zinern und Physiotherapeuten zusammen-zuarbeiten. Und ein Physiotherapeut, der etwa ein Projekt zur Betreuung nach einem Schlaganfall leitet, wäre in der Lage, es wis-senschaftlich zu unterstützen und auch den Aufwand dafür abzuschätzen.
Der Studiengang, der mit dem akade-mischen Grad „Bachelor of Science“ (B. Sc.) abschließt, beginnt immer zum Win-tersemester und bietet Platz für 25 Studie-rende. Die Vorlesungen halten Dozenten nicht nur aus der Abteilung Allgemeinme-dizin und Versorgungsforschung, sondern auch aus anderen Abteilungen von Fakul-tät und Klinikum sowie weitere Lehrbe-auftragte. Sie fnden in den ersten fünf Semestern an einem Nachmittag in der Woche statt, hinzu kommt jeweils eine Ganztagesveranstaltung zu Beginn und Ende des Semesters. sims
www.interprofessionelle-gesundheitsversorgung.de
Neuer Studiengang
„Interprofessionelle Gesundheitsversorgung“
Abiturienten können in Heidelberg nun parallel zur Ausbildung in einem Gesundheitsberuf einen Bachelor-Abschluss erwerben
Studium Interprofessionell
Studium
Interprofessionell
Ausbildung
Hebammenwesen, Logopädie, MTLA, MTRA, Orthoptik, Pfegeberufe, Physiotherapie
Phase I 5 Semester Phase II 3 Semester
Examen Studienbeginn Bachelor of Science
This is a SEO version of 110808_KT_August-September_web_ID17186. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »